Evangelische Kirchengemeinde Zur Heimat

|
Evangelische Kirchengemeinde Zur Heimat
|
 | |
| 24.7.2024 · 8:12 Uhr | ||
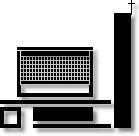
 |
Aktuelles | ||||
 |
Andacht | ||||
| |||||
 |
Gottesdienst | ||||
 |
Gemeinde | ||||
 |
Veranstaltungen | ||||
 |
Gemeindeleben | ||||
 |
Kirchenmusik | ||||
 |
Kinder | ||||
 |
Jugend | ||||
 |
Kontakt | ||||
|
| Reminiszere, 1.3.2015, 11.00 | Jesaja 5,1–7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Lied vom Weinberg
Liebe Gemeinde,
wir müssen heute morgen in Gedanken erst einmal eine Zeitreise machen,
weit zurück, mehr als 2700 Jahre, um auf den Propheten Jesaja zu hören.
Jesaja, auf Hebräisch „Jeschajahu“
(in Deutsch so ähnlich wie „Gotthilf“),
wirkte laut dem nach ihm benannten Buch in den Jahren 740 und 701 vor Christus in Juda,
also im Südreich Israel.
Er war ein höchst unbequemer und souveräner Mann;
immer wieder hat er seinen Zeitgenossen, auch und gerade den Mächtigen seiner Zeit,
unerbittlich, ohne Wenn und Aber, die Wahrheit über die inneren
und äußeren Missstände seiner Zeit auf den Kopf zugesagt.
So, wie das heute mutige Schriftsteller tun,
aber auch Satiriker wie Dieter Nuhr und Harald Martenstein
oder ältere Menschen wie Helmut Schmidt oder Heiner Geissler,
wenn sie gesellschaftliche und politische Zustände aufs Korn nehmen.
Er hat aber nicht immer so betont konfrontativ gesprochen.
Er hat auch versucht, sich an die selbstkritische Einsicht seiner Zeitgenossen zu wenden
und sie aufgefordert, mitzudenken und sich und seine Botschaft
nüchtern und ehrlich im Hören auf Gottes Weisung zu prüfen.
So ein Versuch ist heute der Predigttext.
Da heißt es fast gereimt:
„Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit.“
Jesaja tritt hier nicht als Prediger, sondern als Poet und Sänger auf –
als Sängerpoet, der Gott mit einem Winzer
und Juda mit dem von ihm liebevoll eingerichteten Weinberg vergleicht.
An zentraler Stelle dieses Liedes steht eine Aufforderung, in der eine Frage steckt:
„Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas,
zwischen mir und meinem Weinberg“ –
Die Bürger sollen entscheiden – eine Volksabstimmung also,
das kennen wir ja gut in Berlin; ganz demokratisch klingt das,
und auf dem Zettel in der Wahlkabine könnten die Fragen in etwa lauten:
Als Jesaja diese Fragen stellte,
kannte er bereits aus der Überlieferung Israels zwei Wege,
die Gott in der Geschichte eingeschlagen hatte, um zum Ziel zu kommen.
Da war einmal der Weg der Liebe.
Nie hat Gott sein Volk Israel aufgegeben oder verlassen.
Er hat es sich herausgerufen aus allen Völkern.
Er hat sein Schreien in der Gefangenschaft in Ägypten nicht überhört,
ihm vielmehr in Gestalt des Mose einen Retter geschickt,
der es herausgeführt und ihm einen Neuanfang in Freiheit ermöglicht hat.
Immer wieder hat er es vor Feinden beschützt und behütet.
Und dieses Grundgesetz der Liebe hat er nicht nur Israel gegenüber angewandt.
Die ganze Welt, seine Schöpfung, hat er bis zum heutigen Tage erhalten,
hat es regnen und die Sonne scheinen lassen,
hat verhindert, dass die Menschen diese Welt zerstören.
Bis jetzt immerhin, auch wenn es manchmal so aussieht,
als würden wir es doch noch schaffen.
Und was von der Schöpfung im Ganzen gilt, gilt von vielen Menschen,
die seine Liebe und Güte in ihrem Leben als unverdientes Geschenk
immer wieder ganz persönlich und in ganz unterschiedlichen Situationen
erfahren, – aber immer wieder auch vergessen haben.
Denn das ist ja nun gerade das eigentlich Nicht-Verständliche und Nicht-Normale,
dass wir diese Spuren der Liebe Gottes in der Welt und in unserem Leben
als selbstverständlich ansehen und konsumieren.
Das ist so, als stünde es uns zu,
als gäbe es ein selbstverständliches, naturgegebenes Anrecht
auf Gesundheit, Glück, Frieden, Erfolg oder langes Leben.
Viele Menschen kämen gar nicht auf die Idee, Gott für das viele Gute,
das er uns täglich gibt, zu loben und zu danken.
Sodass sich die Vermutung nahe legt:
Dieser Weg scheint nicht sehr erfolgreich.
Mit der Güte ist Gott häufig nicht sehr weit gekommen.
Viele nehmen ihm seine Güte und seine Güter gern ab,
aber zu ihm hingezogen fühlen sie sich deswegen noch lange nicht.
Darum leuchtet ein, dass Gott es auch auf die andere Weise,
mit einem zweiten Weg versucht hat, mit Strenge und Strafe.
Gerade im Alten Testament sind ja mehrere Geschichten überliefert,
die in diese Richtung weisen:
Etwa die Geschichte von Sodom und Gomorra,
diese Städte, auf die Gott wegen ihres menschenverachtenden,
die Gebote verachtenden Verhaltens einen Schwefelregen fallen ließ,
sodass die Bewohner bis auf ganz wenige Gerettete umkamen.
Oder die Geschichte von der Sintflut, die erzählt, dass es Gott reute,
die Menschheit überhaupt geschaffen zu haben.
Auch der Untergang anderer Reiche in frühgeschichtlicher Zeit
oder die verheerenden Auswirkungen von Naturkatastrophen und Hungersnöten
gehören in diese Kategorie des Strafhandelns Gottes.
Wobei die Strafe häufig gerade darin liegt,
dass Gott nichts macht, dass er schlicht nicht eingreift,
sondern die Völker und ihre Leiter einfach machen lässt
und sie so kopfüber in ihr eigenes Unheil rennen.
Sie richten sich selbst zugrunde.
Gott braucht gar nicht gewaltsam dreinzuschlagen.
Es genügt, dass er uns unseren Kopf, unseren Willen lässt,
uns nicht hindert, sondern laufen lässt, so wie wir es wollen,
und uns nicht vor uns selber schützt.
Katastrophen hatten und haben in der Geschichte eine Zeit lang
eine heilsame, reinigende Wirkung,
aber sie verlieren in der Regel viel zu schnell
ihren mahnenden, aufrüttelnden Charakter.
Zum Leidwesen der Betroffenen sind sie schon nach wenigen Generationen
vom Sand der Geschichte bedeckt, eingeebnet und schließlich vergessen.
Das Buch des Männerkreises der Gemeinde Zur Heimat
„Krieg ist schrecklich, mein Kind“
will 70 Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges
die junge Generation teilhaben lassen an diesem Erleben und Lernen
aus der großen Katastrophe.
Aber wir schauen uns um in der Welt und haben den Eindruck,
als hätte man nichts gelernt.
So zogen die jungen Männer vor 100 Jahren
begeistert und singend in die Schlachten des ersten Weltkriegs,
so gehen auch heute fanatisierte und meist ahnungslose Männer und auch Frauen
nach Syrien oder in den Irak, um dort Helden des Islamistischen Staates zu werden.
Auch sie werden sich selbst zugrunde richten.
Manchmal wünscht man sich, dass Gott hier noch drastischer dem Unheil wehrte.
Das Ergebnis ist:
Durch die Brille der Bibel und mit ihrem Verständnis
der Beziehung zwischen Gott und Mensch sehen wir,
dass Gott weder auf dem Wege der Liebe noch auf dem Weg der Strenge und Strafe
sein Ziel erreicht hat:
Nämlich die Menschen dafür zu gewinnen,
dass sie in Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und in Ehrfurcht vor dem Leben agieren.
Damit ergibt sich die Frage, die schon Jesaja seinen Zeitgenossen gestellt hat:
Was könnte, was sollte Gott noch tun?
Wobei es eine Regel gibt, die Gott nicht bricht:
Er will uns Menschen nicht zu Marionetten seiner Allmacht degradieren.
Er will seine geliebten Geschöpfe vielmehr zu einer freien Zustimmung gewinnen.
Unser Jawort zu Gott, so wie wir das in der Taufe oder Konfirmation sagen,
soll nicht aus Zwang, Gewohnheit oder Gedankenlosigkeit,
sondern aus freiem Entschluss gesagt werden.
Aber wie geht das große Hin und Her,
das Spiel zwischen Gott und dem Menschen dann weiter?
Was ist denn noch denkbar oder möglich außer Zuckerbrot und Peitsche?
Gibt es außer dem Weg der Liebe und dem Weg der Strafe einen dritten Weg?
Die beiden genannten Wege – Zuckerbrot oder Peitsche –
haben eine Gemeinsamkeit: Es sind hoheitliche Wege.
Wege, die das Wirken und Walten Gottes im großen Rahmen
von Schöpfung und Geschichte zeigen;
Wege, in denen er uns mit seiner überlegenen Größe begegnet.
Das ist der Punkt, an dem Jesus erscheint.
Jesaja hat von ihm 700 Jahre vor seiner Geburt wohl manchmal
als dem „Immanuel“, dem Messias der Endzeit oder der Wendezeit geträumt,
hat geahnt, erwartet und prophezeit,
dass Gott noch eine weitere Option für uns hat:
Mit dem Kommen dieses Jesus von Nazareth hat er –
so bekennen wir als Christen –
einen neuen, den dritten Weg eingeschlagen –
nicht hoheitlich, nicht von oben, nicht mächtig,
sondern ganz unten, ganz menschlich, brüderlich, ja ohnmächtig.
Gott kommt uns nahe nicht als Staatsmann oder Heerführer,
sondern als Mensch an unserer Seite,
als Bruder, der seinen Geschwistern von ihm erzählt
und sie einlädt, zu ihm zurück zu kommen;
ein Mann aus einfachen Verhältnissen,
ein Rabbi mit dem gelernten Beruf eines Zimmermanns soll das Herz anrühren
und in den Menschen die Freude zur Heimkehr ins Vaterhaus wecken.
So ist Jesus Christus unter die Menschen gegangen, im Auftrag Gottes,
als der für Gott Werbende, Einladende, Bittende mit der Botschaft,
die dann später der Apostel Paulus auf den Punkt gebracht und weitergegeben hat:
„Lasset euch versöhnen mit Gott“ (2. Kor. 5,20).
Und was hat Gott mit diesem dritten Weg erreicht?
Immerhin nennt sich zurzeit auf dieser Erde fast jeder dritte Mensch nach ihm:
„Christ“ oder „Christin“.
Gescheitert ist Gott nicht.
Aber es scheint auch, dass es kein durchschlagender Erfolg war.
Jedenfalls ist der Sohn nur von einigen angenommen,
von vielen aber auch abgelehnt, verfolgt und schließlich ans Kreuz geschlagen worden.
Viele weigern sich bis heute, die Botschaft Jesu Christi
als Liebesbotschaft Gottes zu erkennen oder gar anzunehmen.
Nun sind wir gefragt:
Was könnte Gott noch tun?
Wir haben von den drei Versuchen, die er unternommen hat, gehört.
Sie sind allesamt nur bei einigen, aber nicht bei allen,
und damit nicht wirklich durchschlagend zum Ziel gekommen.
Die Frage drängt sich auf:
Was würden wir, wenn wir dazu aufgefordert würden,
in dieser Gesamtlage Gott raten?
Aus unserer menschlichen Einsicht gibt es in dieser Situation für Gott
zwei Möglichkeiten: Aufgeben oder Weitermachen.
Bisher hat Gott – wie ich meine, zu unserem Glück und Heil –
nie aufgegeben.
Auch die Kreuzigung des Sohnes hat er hingenommen.
Und Tag für Tag werden wieder Menschen
gekreuzigt, geköpft, entführt, vergewaltigt, erniedrigt –
Menschen, die sich auf diesen Jesus berufen.
Aber Gott hat eine unerwartete Antwort gegeben, indem er den Sohn auferweckte.
Damit hat er gezeigt:
Wo ihr Menschen mit eurer Ablehnung auch zum letzten Mittel greift,
wo ihr meinen Gesandten tötet, wo ihr meine geliebten Kinder umbringt,
da fange ich ganz neu wieder an.
Ich, der Schöpfer, euer Herr und Vater, gebe nicht auf.
Christus bleibt mein Angebot.
Seine Worte sollen gehört werden, und zur Besiegelung und Unterstreichung dafür,
dass ich hinter diesem Sohn unverändert stehe,
habe ich ihn auferweckt und neben mich auf den Herrscherthron gesetzt.
Ich bleibe dabei – weil ich Gott bin und weil es zu eurem Heil ist.
Damit sind die beiden früheren Wege nicht aufgehoben.
Sie bleiben gültig.
Darum ist es sinnvoll und richtig,
auch heute über eine solche Stelle aus dem Propheten Jesaja zu predigen.
Wir dürfen hoffen und vertrauen, dass Gott so wie bisher nicht aufgeben wird,
nie vor den Menschen kapitulieren wird,
sondern seinen Weg weitergehen wird –
bis zu dem Tag, an dem ihn alle anbeten und nach seinen Weisungen leben werden.
Dann wird Schalom sein, Frieden zwischen den Völkern und Religionen,
dann wird Gerechtigkeit herrschen, dann ist der Weg Jesu Christi zu seinem Ziel gekommen.
Unerkannt ist er mitten unter uns am Werk.
Die UNO wird es – so wie sie heute agiert – nicht allein schaffen.
Sie braucht diese göttliche Hilfe, die nicht mit Gewalt,
sondern mit der Macht der Ohnmächtigen kommt.
In unserem Evangelischen Gesangbuch (Lied 94) findet sich
ein wunderbarer poetischer Liedtext von Kurt Ihlenfeld (1901–1972),
einem früheren Mitglied dieser Gemeinde
(eine Plakette an seinem ehemaligen Wohnhaus in der Straße Heimat erinnert an ihn);
in diesem Lied „Das Kreuz ist aufgerichtet“ fasst er in kurzen Worten zusammen,
was Gottes gnädiges Handeln mit uns Menschen ausmacht:
Pfarrer Kurt Kreibohm
| |||||||||||||||||||||||||||||||