Evangelische Kirchengemeinde Zur Heimat

|
Evangelische Kirchengemeinde Zur Heimat
|
 | |
| 27.7.2024 · 6:18 Uhr | ||
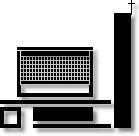
 |
Aktuelles | ||||
 |
Andacht | ||||
| |||||
 |
Gottesdienst | ||||
 |
Gemeinde | ||||
 |
Veranstaltungen | ||||
 |
Gemeindeleben | ||||
 |
Kirchenmusik | ||||
 |
Kinder | ||||
 |
Jugend | ||||
 |
Kontakt | ||||
|
| 1. Sonntag nach dem Christfest, 28.12.2014, 11.00 | Lukas 2,22–40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Alten
Liebe Gemeinde,
Ja, auch diese Geschichte gehört zum Weihnachtskreis.
Auch sie steht in Lukas 2.
Acht Tage nach seiner Geburt wurde Jesus wie jeder jüdische Knabe
zur Beschneidung gebracht.
Sie ist Zeichen des Bundes mit dem Volk Israel.
Mit der Beschneidung war und ist auch heute noch die Namensgebung verbunden.
Erst jetzt heißt der Heiland ganz offiziell „Jesus“.
Wo diese Beschneidung stattfand, wird nicht erwähnt;
evtl. geht Lukas von Bethlehem aus.
Danach (mindestens 33 Tage später, lt. Schmithals),
gehen Maria und Joseph nach Jerusalem in den Tempel zur „Darstellung“.
Es geht hier noch um ein anderes Ritual, das Reinigungsopfer:
Nach dem Alten Testament musste jede Wöchnerin ein Opfer geben.
Es bestand im Normalfall aus einem Schaf zum Brandopfer und einer Taube zum Sühnopfer.
Arme Leute durften sich mit zwei Tauben begnügen.
Wenn Maria und Josef jetzt zwei Tauben opferten,
dann zeigt dies ihre momentane Armut.
Und in dem Augenblick kommen Simeon, von dem wir schon gehört haben, später
Hanna dazu.
Das Wort „Simeon“ bedeutet wörtlich „Erhörung“.
Der Heilige Geist ließ ihm eine spezielle Botschaft zuteil werden.
Wohl war er alt, aber immer noch ein wacher, kräftiger Prophet des Herrn –
auch wenn er nicht ausdrücklich als Prophet bezeichnet wird.
Im Unterschied zu Hanna, von der gesagt wird, dass sie eine Prophetin sei.
Simeon weiß oder ahnt, dass er bald sterben muss.
Aber er kann nun diesem Sterben getrost in die Augen sehen, weil er Gottes Heil gesehen hat.
Er sieht hier mehr, als ein gewöhnliches Auge
in den ärmlichen jungen Eltern mit ihrem Baby sehen kann:
Er sieht das Heil, das Gott vor allen Völkern bereitet hat
Gott wird in Simeons Gebet als „Herr“ angesprochen,
er selbst bezeichnet sich als „Knecht“
bzw. „Sklaven“ oder „Diener“.
Der Herr und Besitzer „entlässt“ seinen Knecht.
Normalerweise haben für abhängig Beschäftigte
die Worte „entlassen“ oder „Entlassung“ einen bedrohlichen Klang.
Simeon aber erfährt seine Entlassung als eine wunderbare Befreiung, als Erlösung.
Gott hält sein Versprechen, er beschenkt seinen treuen Diener,
er lässt den alten Mann nicht fallen, sondern „in (den) Frieden“ ziehen.
Frieden bedeutet also Heil. Damals wie heute.
Simeons Augen haben „das Heil gesehen“.
Simeon, der nie resigniert hat, obwohl er oft genug Grund dazu gehabt hätte,
Simeon, der statt dessen ein Leben lang die Sehnsucht
nach Gott und seiner Gerechtigkeit wach gehalten hat –
hier und jetzt findet seine Sehnsucht ihr Ziel.
Seine Entlassung ist nicht Beraubung, sondern Erfüllung.
Sie bringt nicht Trauer, sondern Freude.
Freude, die lebendig macht, Seele und Leib.
Und das gilt allen Menschen, Juden wie den noch heidnischen –
Völkern der Welt.
Maria und Josef wunderten sich,
sie „staunten“ über die Worte des geisterfüllten alten Mannes,
der sie als Eltern segnet.
Und er ist der erste Mensch im Lukasevangelium, der ihr Kind Jesus als Messias bezeichnet.
Das klingt großartig, aber wie muss es auf sie wirken, als sie hören,
dass dieser Messias ein leidender Messias sein wird;
und dass seine Mutter an seinen Schmerzen, an seinem Verhalten,
vielleicht auch an manchen schroffen Predigten, mitleiden wird:
An ihm werden sich die Geister scheiden.
Und dann kommt Hanna.
Sie ist die fünfte bei dieser merkwürdigen Begegnung im Tempel:
Auch Ihr Name trägt eine tiefe Bedeutung und Symbolik:
Hanna heißt „Gnade“.
Lukas nennt Hanna eine „Prophetin“ –
ein Titel, der im Alten Testament nur wenigen Frauen ausdrücklich zuerkannt wird.
Hanna, so hören wir, entstammt einer gottesfürchtigen Familie
aus dem Stamm Asser oder Ascher, einem der verloren gegangenen Stämme im Nordreich Israels,
auf dem Gebiet des heutigen Libanon.
Mit dieser Herkunftsangabe macht Lukas deutlich:
Menschen aller zwölf Stämme, auch der im Laufe der Zeit eroberten
oder an fremde Herrscher übergegangenen, warten auf den Messias.
Er wird das unterjochte und zerstreute Volk wieder sammeln.
Hanna ist 84 Jahre alt.
Diese Altersangabe benennt mehr als ein hohes Alter.
84, das sind sieben mal zwölf Jahre.
Die Zahl Sieben steht für Fülle und Ganzheit, für Vollkommenheit;
die Zwölf erinnert an die Vollgestalt Israels, an die Vollzahl seiner Stämme.
Hannas Lebensalter signalisiert so,
dass es Zeit ist für die Befreiung und Sammlung des Volkes,
dass für Israel die Heilszeit gekommen ist.
Diese Frau ist eigenständig –
als Witwe ist sie nicht mehr einem Mann zu- oder untergeordnet.
Hanna lebt im Tempelbezirk. Fasten und Beten prägen ihren Alltag.
Dieses fromme Leben im Tempel steht in deutlichem Gegensatz
zur Lebensform der Aristokratie der Priester, die mit den Römern kooperieren.
Priester, „Bonzen“, Männer, die Macht haben und Prestige suchen.
Hannas stilles Leben dagegen bezeugt den einen, den einzigen Gott Israels.
Mit ihrem Dasein kritisiert sie die politisch Mächtigen.
Und dann ist sie es, die anders als Simeon auch öffentlich das Wort ergreift,
eine Predigt in einer Ecke des Tempels hält:
Die erste weibliche Predigt nach Jesu Geburt, könnte man sagen.
Das Jesus-Kind, so erkennt Hanna, kommt im Auftrag dessen, der aller Herren Herr ist.
Mit diesem Kind gelangt Erlösung nach Jerusalem,
gelingt Israels endgültige Befreiung.
So kündigt Hanna –
wie zuvor Maria in ihrem Lobgesang
(Lk. 1,46 ff) – einen Herrschaftswechsel an.
Die brutale oder geschmeidige Gewaltherrschaft, die die Menschen erleben,
hat nicht das letzte Wort.
Es kommt die gute Zeit der Gottesherrschaft.
Wie Simeon und Maria hat Hanna den Mut, das Kommen des Lichts allen Menschen zu verkünden,
die das Dunkel lähmt und ängstigt.
So endet diese Geschichte.
Was zunächst aussieht wie eine schöne Geschichte
zu Besuch im Tempel „bei Opa und Oma“,
entpuppt sich bei genauem Hinsehen
als eine an-rührende und auf-rührende Botschaft des Lukas-Evangeliums:
Von Lukas, dem „Evangelisten der Armen, der Frauen und des Gebets“
so hat ihn der verstorbene Berliner Prof. für Neues Testament Walter Schmithals
einmal bezeichnet.
Liebe Gemeinde, was ist die Botschaft von Lukas an uns und für uns?
Mit Hanna wird uns eine selbstbewusste, eigenständige Frau vorgestellt,
fast eine „unwürdige Greisin“, wie sie Bertolt Brecht einmal beschrieben hat.
Und in Simeon wird uns ein starker alter, zärtlicher Mann gezeigt,
der sich liebevoll, ja anrührend einem Baby zuwendet.
(Gerade hat jetzt in seiner Weihnachtspredigt Papst Franziskus
von der Zärtlichkeit Gottes im Umgang mit den Menschen gesprochen).
Wichtig ist: Beide sind alt. Nanu! Haben die Alten etwas zu sagen? Hört man auf sie?
Wie ist das mit dem Alter und Altwerden?
Die Bibel kennt die Ambivalenz des Alters, seine Schattenseiten und die Lichtblicke.
Schwäche und Größe,
Torheit und Weisheit,
Eigensinn und kluge Zurückhaltung liegen oft dicht beieinander.
Die Autoren der Heiligen Schrift sind nüchtern und realistisch.
Altern und Sterben bedeutet meist zunehmende Hilflosigkeit, Gebrechen, Scheitern.
Wo es aber gelingt, sein Leben mit all seinen Gebrechen Gott zu übergeben,
da wird es zu einer Form des Lobes Gottes
(Psalm 71,18ff).
Menschen wie
Jakob (1. Mose 48,10),
Isaak (1. Mose 27,21),
Mose (5. Mose 34,7),
Eli (1. Sam 3,2) und andere schauen in ihrem Alter nicht nur rückwärts,
sondern sie harren, sie blicken dem Kommenden entgegen.
Erinnerungen sind ein Reichtum des alten Menschen.
Doch nur in der Erinnerung an die Vergangenheit zu leben, hindert den Menschen,
sich weiterzuentwickeln.
Unser Altwerden kann für uns im Glauben dann eine Bedeutung erfahren,
wenn es uns die menschliche Bedürftigkeit vor Gott sichtbar macht
und uns dazu anhält, im Wissen um unsere Grenzen das Entscheidende –
die Vollendung unseres Lebens – von Gott zu erwarten.
Man wird im Alter ja doch gezwungenermaßen
bescheidener in seinen Glücksansprüchen an das Leben,
dankbarer für jede kleine Freude, Schönheit und Zuwendung.
Manche aber verzweifeln auch,
leiden an Krankheit und Gebrechen,
versinken in Altersdepression.
Diese Geschichte von Simeon und Hanna macht Mut, erinnert uns,
dass wir uns nicht panisch an das Diesseits klammern müssen.
Sie zeigt auf, dass wir lernen sollten, loszulassen,
und dass man in diesem Loslassen Frieden findet.
Warum? Weil wir vertrauen dürfen, dass Gott „bei uns“ ist, dass er da ist,
in diesem Jesus Christus ein für allemal als menschlicher,
als gnädiger, mitfühlender Gott.
Als Kind, aber auch als Leidender, als Gebrechlicher und Gebrochener am Kreuz.
Aber das ist ja eben nicht alles:
Die Macht des Todes ist zerstört, Karfreitag ist nicht das Ende.
Und das wiederum macht das Alter dann so spannend,
denn von Ostern her, Im Licht der Auferstehung Jesu dreht sich die Zeitachse plötzlich um:
Alte gehen voran, sie sehen den Weg und das Heil eher als die anderen,
sie sind plötzlich die Jungen, die Wachen, die Wegweiser,
die Avantgarde des Glaubens.
Simeon und Hanna sind so für uns Symbolgestalten
dieses geduldigen, hoffnungsvollen, gespannten Ausschauens nach dem Kommen Gottes.
Vor diesem Hintergrund heißt Altwerden nicht Hände in den Schoß legen,
sondern gespannt bleiben, neugierig bleiben.
Nicht Ruhestand, sondern Unruhestand.
Das merke ich sogar im Sterbe-Hospiz, in dem ich als Seelsorger tätig bin. –
Jeder Tag, jedes Gespräch, jedes Erleben ist noch so unendlich wichtig und wertvoll,
bis hin zu den Festen, die wir feiern,
den Bildern, die die Sterbenden malen,
den Liedern, die wir singen,
den Gesprächen,
den Abendmahlsfeiern.
In allem steckt die Sehnsucht nach einem erfülltem Leben, von dem die Bibel sagt:
„alt und lebenssatt“;
die Gnade, dass wir eines Tages dankbar sagen können:
Ja, Gott, wir sind bereit, wir können jetzt gehen und das Zeitliche segnen,
die Zeit, die wir hatten, in deine Hände legen;
die Menschen segnen, die noch Zeit vor sich haben;
die Jüngeren eben, besonders die Kinder, denen so viel Leben noch bevorsteht.
In früheren Zeiten hat man das Alter
immer mit großem Respekt und Ehrfurcht behandelt.
Man hat den Alten auch noch eine große Verantwortung zugetraut
und sie nicht aussortiert oder aufs Altenteil abgeschoben:
das Alter wurde sogar zum Maßstab der Regierungsweisheit gemacht,
das lateinische Wort „Senat“, wörtlich der „Rat der Greise“,
erinnert daran.
Man wollte sie in dieser Verantwortung haben, weil man sie nicht mehr korrumpieren konnte,
weil man sie weder mit Geld, schönen Frauen
oder anderen Reizen bestechen bzw. verführen konnte.
Auch heute ist es immer wieder erstaunlich,
dass sich das Interesse gerade der Jüngeren
angesichts so vieler Skandale in Politik und Wirtschaft wieder den Alten zuwendet:
auf die man hören will.
Seien es Helmut Schmidt,
Heiner Geissler,
Egon Bahr,
Hildegard Hamm-Brücher,
Rita Süssmuth,
Hans-Dietrich Genscher oder eben
Papst Franziskus.
Liebe Gemeinde, ich wünsche uns, dass wir im Altwerden
nicht nur die Urlaubsstrände, Kreuzfahrtschiffe und die Philharmonie bevölkern,
so schön das ist,
sondern uns auch weiter einmischen und mitmachen wie diese Genannten,
dass wir mit der Kraft und auch der Unabhängigkeit, die uns noch geschenkt sind,
den Mund auftun für die, die sich nicht trauen,
dass wir die Erkenntnisse und Erfahrungen unseres Lebens,
unsere „Lebensweisheiten“, ohne Eitelkeit zur Verfügung stellen.
Und dass wir auch im Alter an unserem Ort
Verkünder und Bezeuger des Glaubens an unseren Heiland Jesus Christus sind,
wie Hanna und Simeon es waren. Amen.
Pfarrer i.R. Kurt Kreibohm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||