Evangelische Kirchengemeinde Zur Heimat

|
Evangelische Kirchengemeinde Zur Heimat
|
 | |
| 27.7.2024 · 9:33 Uhr | ||
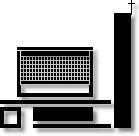
 |
Aktuelles | ||||
 |
Andacht | ||||
| |||||
 |
Gottesdienst | ||||
 |
Gemeinde | ||||
 |
Veranstaltungen | ||||
 |
Gemeindeleben | ||||
 |
Kirchenmusik | ||||
 |
Kinder | ||||
 |
Jugend | ||||
 |
Kontakt | ||||
|
| 22. Sonntag nach Trinitats, 4.11.2012, 11.00 | Römer 7,14–25a | ||||||||||||||||||||||||||
|
Stolz
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!
Im Frühjahr, im März genauer gesagt, liebe Gemeinde,
habe ich mir ein paar Tage Urlaub genommen:
Es musste endlich etwas passieren, vor dem Sommer.
Ich habe am Pfarrhaus eine Terrasse gebaut, ganz allein.
Von der Idee über die Materialbeschaffung
bis zur letzten Schraube, alles allein.
Einige unter Ihnen haben das Werk meiner Hände und meines Kopfes
schon gesehen, ausprobiert.
Ich gebe hiermit bekannt, dass die Pfarrhausterrasse immer noch steht,
auch noch ungefähr da, wo ich sie hingestellt habe,
und bin guten Mutes, dass sie auch im nächsten Frühjahr da noch ist.
Gelegentlich – nicht nur gelegentlich scheine ich das zu brauchen:
Etwas fertig bringen, was dann einfach da steht,
unanfechtbar gelungen, vollkommen (na ja, fast).
Etwas zum Anfassen, zum Betreten, meiner eigenen Hände Werk.
Stolz sein dürfen, zufrieden zumindest.
Ich zeige mein Meisterwerk all meinen Besuchern im Pfarrhaus, na klar.
Eine immer wiederkehrende Reaktion:
„Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut.“
Als Lob gemeint, denke ich. Jedenfalls dem Tonfall nach
und dem „bewundernden“ Lächeln (oder täuscht das?).
Was haben die damit aber gesagt?
„Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass du etwas kannst.
Noch gar zu Ende bringst.“
Gut, vielleicht nur: Nach den drögen Predigten, die wir da immer hören,
scheinbar von Tiefsinn triefend, aber schwer nachvollziehbar,
sowieso in einem verlorenen, verdorbenen Genre vorgetragen –
jetzt plötzlich eine gewisse Meisterschaft
auf einem ganz anderen Gebiet: handwerklich begabt.
Deuten wir das mal so – ich tue es jedenfalls, mir selbst zur Güte.
Sie merken: Ich erzähle das mit einer gewissen Selbstironie.
Abgesehen davon, dass die Terrasse am Pfarrhaus
unsere Lebensqualität in der entsprechenden Jahreszeit
ein bisschen hebt, geht es mir jetzt um meinen Stolz.
So dahingestellt, hört sich das schon zwiespältig an:
Stolz ist etwas, was sich protestantisch eigentlich verbietet,
Bescheidenheit ist eine Zier.
Stolz sein, manchmal, dürfen wir schon. Stolz haben – niemals.
Da lauert ganz anderes.
Als Haltung ist Stolz nicht zu ertragen und auch nicht zu gestatten.
Schon gar nicht sich selbst.
Und doch kommen wir nicht umhin, uns selbst zu suchen.
Uns selbst wiederzufinden in Reaktionen: In den Augen der anderen,
im Gemurmel der Leute hinter dem Rücken,
in anerkennenden Gesten, irgendwie.
Wer sind wir eigentlich? Und wer sagt uns das?
Ich bin – das kann ich Ihnen allen versichern –
der netteste Mensch von ganz Berlin.
Aber: Wenn es keiner merkt, keiner mir zurückspiegelt,
kann ich mir solches Sein abschminken, dann ist es nicht so.
Meinen Töchtern habe ich damals über den Kinderwagen
oder die Wiege gebeugt immer wieder geduldig erklärt,
sie wären doch die glücklichsten Babys von ganz Nordeuropa.
Es hat nichts genützt, sie haben weiter geweint, geschrien,
bis sie erreicht hatten, was sie wirklich wollten –
oder Schlaf und verzweifelte Erschöpfung sie übermannten.
Meine Wahrheit war ihnen egal, sie war nicht spürbar.
Ihr Selbsterleben war etwas ganz anderes.
Wer sind wir? Wer sagt uns, was wir wirklich sind?
Wir sind, was wir sind, im Spiegel der anderen.
Wir sind das, was uns gelingt in diesen Spiegel hineinzuzeichnen,
denn der Spiegel der anderen ist bestechlich.
Wir sind in Wahrheit das, was wir darstellen,
was wir von uns her machen und wovon wir überzeugen können.
Immer abhängig von den Reaktionen auf uns von gegenüber,
von den Gerüchten und Urteilen, die über uns gestreut werden,
im Umlauf sind. Wehe, wenn wir sie nicht einholen können.
Wir sind, was wir sind, durch das, was zu uns zurück kommt,
was uns über uns gesagt wird, angedeutet, zu spüren gegeben.
Wir haben heute einen Bibelabschnitt als Höraufgabe,
in dem es um genau das alles geht.
Er ist vielleicht der komplizierteste Abschnitt der Bibel:
Natürlich Paulus, im Brief an die Römer, Kapitel 7.
Auch er erzählt von sich, gewagt.
Es geht nicht um eine Lehre vom Menschen: So sind sie.
Es geht um ihn: Bei mir funktioniert das so,
ich bin mir auf der Spur, ich weiß, wie ich funktioniere,
was mich aufbaut, was mich krank macht.
Und ich erzähle euch jetzt einmal, wie es mir mit mir geht.
Erzähle euch das, weil ich vermute, dass es bei euch so ähnlich ist.
Muss nicht unbedingt, aber es spricht vieles dafür.
Paulus, der Menschenkenner, vor allem der schonungslose
Selbst-Erkenner war schon fast 2000 Jahrtausende vorher
auf der Spur Siegmund Freuds.
Seine Selbstwahrnehmung zwischen Gesetz, Ich und Fleisch
entspricht ein bisschen dem Verhältnis von Überich, Ich und Es.
Aber bevor ich Ihnen – uns das vorführe: Das Ende des Abschnittes.
Paulus führt sich selbst vor, beispielhaft, und ruft aus:
„Ich elender Mensch!
Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe?“
Dass die Fleischeslüste des Leibes dann auf sexuelle Begierden konzentriert, um nicht zu sagen reduziert werden, ist eine spätere Spezialität des Abendlandes, die wir dem heiligen Augustinus verdanken: Der hat sich dort ertappt. Bei Paulus ist das viel umfassender: Es geht um den Drang, das Bedürfnis, ja den Zwang zur Selbstbestätigung. Es geht um das Alleinsein und die verzweifelten Mechanismen, mir Anerkennung, mir Geliebtwerden zu verschaffen. Oder auch nur wenigstens Beachtung, Wahrgenommen werden. Und sein Fazit: Es funktioniert nicht. Was gut scheint, ist böse, weil ich es benutze zu eigenen Zwecken. Was richtig ist, ist falsch, weil ich aus dem Richtigen viel zu viel Blut sauge, es missbrauche für mich selbst. Es ist ausweglos. „Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe?“ Dieser Aufschrei am Schluss bekommt bei Paulus noch eine Antwort: „Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn!“ Das ist sozusagen die Bombe am Schluss, die positive Bombe, die Paulus platzen lässt, nachdem er uns in seine Sackgasse mitgenommen hat. Die Sackgasse muss man, auch frau – müssen wir alle gehen. Sie führt auf eine Wand zu, an der wir alle zerschellen. Das Leben gelingt einfach nicht. Wir geben uns Mühe, machen Kopfstände, verleugnen uns selbst. Es nützt alles nichts. Und wo es zu nützen scheint, stellt sich das als um so größerer Selbstbetrug heraus. Und dann, am Ende der Straße, geht die Tür auf, scheint plötzlich Licht. Es ist ein schönes Sinnbild, dass die Sackgasse „Heimat“ an ihrem Nordende hier bei uns in diese Kirche führt und letztlich vor das Kreuz hier draußen, das unübersehbar in der Mitte steht: Erlösung. Überraschend für alle, die hier hereinkommen: Keine übliche Kirche mit dem Verdacht, hier wird mit himmlischer Lehre die Gegenwart zugekleistert. Sondern eine sichtbare Durchlässigkeit: Wenn, dann führt der Weg zu ihm und nur zu ihm. Der Johannes am Ende der Reliefreihe an der Wand zeigt mit seinem überlangen Zeigefinger dorthin. Die Antwort des Paulus: Er ist es. Alles Ausweglose erhält mit ihm seine Antwort. Und seine – unsere Antwort heißt dann nicht Verzweiflung, sondern nur noch: Danke! „Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn!“ Ich lese jetzt erst einmal den Abschnitt ganz.
Wir haben am Freitag auf der Kreissynode Paulus schon einmal gehört.
Die Übersetzung, die da verwendet worden ist, hat mich sehr verwirrt,
ich habe auch noch nicht herausbekommen, wo die her war.
Wenn ich es richtig gehört habe, würde ich sagen:
Es war ein Verfälschung.
Ein Versuch sozusagen, das jüdische Gesetz vor Paulus zu retten.
Paulus unterscheidet ja gerade nicht zwischen
Vorschriften und Mechanismen, die für Menschen leider gelten,
denen wir hilflos ausgeliefert sind und die uns immer wieder
auf Abwege verführen einerseits
und der biblischen Thora andererseits: die fünf Bücher Mose,
die als helfendes Gesetz Gottes gelten.
Seine Logik heißt: Genau dieses gute Gesetz Gottes
wird von uns Menschen zu eigennützigen Zwecken missbraucht.
Weil es uns nämlich ganz schnell nicht mehr nur den Weg weist,
sondern dazu missbraucht wird,
uns unsere eigene Großartigkeit zu beweisen.
Weil es, so wie wir Menschen nun einmal sind,
jedenfalls ich, Paulus, war und bin,
nur noch dazu dient, mich selbst zu bestätigen und zu beweisen.
Wir missbrauchen Gott für unseren eigenen
zwischenmenschlichen Wettbewerb.
Die Zusammenhänge, in die wir geraten mit dem Gesetz, führen dazu,
dass Gott nicht Gegenüber, sondern nur Mittel zum Zweck wird.
Und der nächste, wahrscheinlich sogar derselbe Schritt ist es,
auch alle anderen Menschen nur noch so zu missbrauchen,
zumindest aber immer auch zu missbrauchen:
Die Gesellschaft von Menschen ein Steinbruch für Trophäen.
Was schaffe ich? Was bleibt von mir, was ich tue?
Immerhin – bei mir – eine Terrasse.
Es ist überdeutlich: Das Abendland hat trotz zweier Jahrtausende
von Paulus nicht gelernt (übersetzt heißt sein Name nur: Herr Klein!).
Unsere Kultur macht die Selbstdarstellung nach wie vor
und sogar immer mehr zum Mittelpunkt alles Wollens und Tuns.
Professionalität wird das dann genannt, Durchsetzungsfähigkeit.
Die von allen Skrupeln befreite Selbstbeweihräucherung
von Menschen, die von sich wissen, dass sie die Elite sind,
ist uns am Freitag dann auch deutlich vorgeführt worden:
Als Einstellungskriterium für eine Unternehmensberaterin.
Es ist ein schmaler Grat zwischen Selbstbeweihräucherung
und einfach nur erlaubtem, zu förderndem Selbstvertrauen.
Jesus Christus heißt der Ausweg des Paulus:
Der auf den Beweis durch Erfolg verzichtet hat,
der diesen Beweis nur aus Gottes Hand nahm,
und uns mitnimmt auf seinen Weg.
Wenigstens Paulus mitgenommen hat, aber uns einlädt.
Amen.
Pfarrer Hartmut Scheel
| |||||||||||||||||||||||||||